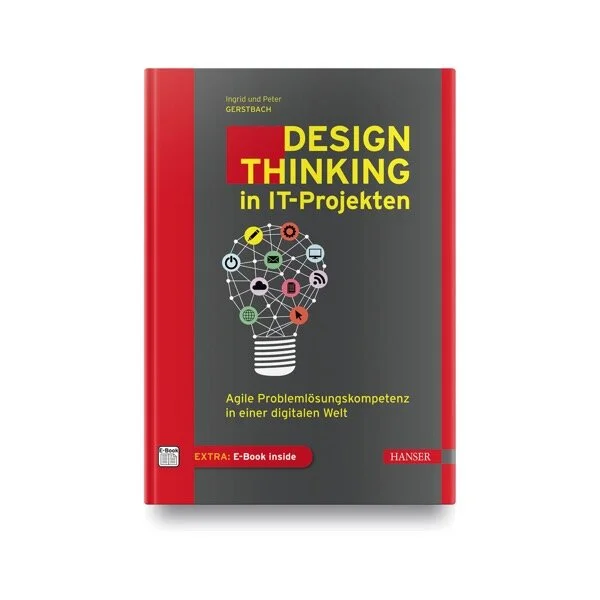Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie eigentlich „normal“ sind? Vielleicht haben Sie nachgedacht, ob eine bestimmte Eigenschaft oder ein Verhalten nicht ganz einem wahrgenommenen Ideal entspricht. Oder vielleicht haben Sie sich einfach nur gefragt, ob Sie so denken, handeln und leben „wie alle anderen“?
Nur wenige von uns sind immun gegen die mysteriöse Kraft des sogenannten Normalen. Ich selbst verbrachte mein halbes Leben damit, mir vorzustellen, wie viel glücklicher und besser mein Leben wäre, wenn ich mehr wie andere Menschen sein könnte. Eines Tages stellte ich die Frage anders. Ich begann mich zu fragen, wer denn all diese sogenannten normalen Menschen da draußen überhaupt sind. Und je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigte, desto mehr kam ich ins Zweifeln, ob so etwas wie „normal“ überhaupt existiert. Also begann ich zu forschen.
Vor dem frühen 19. Jahrhundert wurde das Wort normal nur im mathematischen Kontext als Synonym für einen rechten Winkel benutzt. Erst 1835 entstand eine Vorstellung der Normalität, die wir heute auch nutzen. Adolphe Quetelet, ein belgischer Astronom und Statistiker, begann, menschliche Merkmale wie die Körpergrößen tausender Menschen miteinander zu vergleichen. Die Daten visualisierte er auf einer Achse und erhielt dadurch eine Normalverteilung bzw. Gaußsche Kurve. Die Gaußsche Kurve wurde erst kurz davor von den Mathematikern Carl Friedrich Gauß und Pierre-Simon Laplace eingeführt. Damals wurden diese Berechnungen vor allem in der Astronomie eingesetzt, um die Umlaufbahn von Kometen und Planeten zu erforschen. Den Forschern war bewusst, dass die ganzen Messungen immer mit Fehler behaftet und ungenau waren. Sie gingen allerdings davon aus, dass je mehr Messungen sie am selben Objekt durchführten, desto genauer konnten sie die Entfernung oder Flugbahn eines Planeten bestimmen.
Quetelet verfolgte die Idee, dass die Normalverteilung auch für Menschen gilt: Wer näher am Durchschnitt lag, lag damit auch näher an einer idealen Art. Der Durchschnittsmensch (l’homme moyen), wie Quetelet ihn nannte, formierte sich in Bezug auf Körper, Geist und Verhalten zum idealen Menschen. Damit etablierte Quetelet die Vorstellung, dass Durchschnitt und Ideal ein und dasselbe sind.
Die Definition von normal wurde zu einem populären Verständnis, das auch die Medizin und Wissenschaft durchdrang. Dabei variiert die Vorstellungen darüber, was als normales Verhalten gilt, je nach Zeit und Ort. So gibt es Aufzeichnungen einer Patientin eines Irrenhauses, die als verrückt eingeliefert wurde, da sie sich 1898 weigerte im Freien einen Hut zu tragen. Danach haben Frauen im spätviktorianischen England die Menschen empört, wenn sie sich kurze Haare schneiden ließen oder Hosen trugen. Aber der Begriff kann auch örtlich variieren: So nehmen Peruaner ihre Getränke bevorzugt lauwarm zu sich: Cola, Bier, Tee, Kaffee – egal. Es gibt kein Tabu – eine Vorstellung, die manch Europäer grausen würde.
Quetelets Begriff Durchschnittsmensch impliziert, dass Normalität eine Art universeller Standard ist – dabei werden die Erwartungen von einer viel kleineren Untergruppe von Menschen herangezogen. Die Daten, die zur Bildung des Durchschnitts verwendet werden, werden in der Regel durch vorherige Annahmen eines Wissenschaftlers darüber ausgewählt, der bestimmt, was in dem konkreten Fall als normal gilt. Das Ergebnis ist dann eine verzerrte Vorstellung, die eine bevorzugte Gruppe als besonders repräsentativ darstellt. Normal zu sein hieß beispielsweise für Quetelet, männlich zu sein. Für Francis Galton, der neben der Eugenik den Begriff der Normalverteilung einführte, bedeutete normal ein männlicher Bürger aus der Mittel- oder Oberschicht.
Es ist fast so, als hätten wir im Laufe der Zeit nicht gelernt, dass sich unsere Annahmen über das Seltene oder Außergewöhnliche immer wieder als genau das erweisen: Annahmen. In den 1970er Jahren wurde ein soziales Modell der Behinderung entwickelt, das besagt, dass behinderte Menschen nicht durch ihre körperlichen Eigenschaften oder ihren Gesundheitszustand behindert werden, sondern durch eine Gesellschaft, die sich nicht an ihre Bedürfnisse anpasst: eine Gesellschaft, die für den sogenannten Durchschnittsmenschen geschaffen wurde.
Trotzdem hinterfragen viele Menschen Tag für Tag ihre eigene Normalität. Manches Mal kann das sehr nützlich sein: Als meine Bauchschmerzen immer öfter kamen und heftiger wurden, meinte mein Mann, dass das nicht normal sei und ich zum Arzt sollte. So wurde ein Tumor gefunden. Die Vorstellung von Normalität hat eben manches Mal zwar einen Nutzen - und trotzdem müssen wir uns fragen, welche Normen wir genau als Vergleich heranziehen. Schaffen wir durch das Ziehen von Vergleichen unwissentlich Annahmen über Klasse, Rasse, Geschlecht oder Sexualität? Jahrhunderte lang haben uns Wissenschaftler genau dazu aufgefordert und diese Vorstellungen sind so tief in unser Leben eingebettet, dass wir oft nicht einmal bemerken, dass sie existieren.
Wenn ich könnte, würde ich mein jüngeres Ich beruhigen und ihm sagen, dass es nichts bringt sich mit einem Durchschnitt zu vergleichen. Durchschnitt ist nicht gleichbedeutend mit gesund oder glücklich. Und niemand kann überall den Durchschnitt erreichen – das ist statistisch gesehen einfach unmöglich. Wenn Sie sich ein Ziel setzen wollen, das Sie erreichen möchten, denken Sie lieber darüber nach, was Sie erreichen wollen. Die normalen Standards, die unsere Geschichte geprägt haben, verstärkten im Allgemeinen eher unsere Vorurteile über Geschlecht, Rasse, Behinderung und soziale Klasse. Am Ende ist aber das, was in der Menschheit am weitesten verbreitet ist, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Und das ist doch mal eine gute Nachricht.